 …
…
Ich sprach vom „Moralismus“ , daß man fälschlicherweise immer die Moral an den Anfang setzte, die Verhaltensweisen als das Entscheidende ansah, das Gute rangieren ließ vor der Wahrheit, daß sehr viel Kitsch einzog, daß der Wert und die Notwendigkeit des Schönen allzu gering geachtet wurden: man glaubte, all dies würde 1962 überwunden.
„Aha“, sagten viele, „endlich kommt die Zeit einer Vertiefung. Endlich wird die Gemeinde, werden die Gläubigen eingeführt in die Tiefen der Wahrheit. Die Primitivität hört auf, ebenso der Pharisäismus, der falsche Moralismus.
Es wird im echten Sinne Jesu humaner werden. Die Kirche erneuert sich, so daß es sich besser leben und freier atmen läßt im Innenraum der Kirche. Man wird fragen und miteinander reden können über die Geheimnisse des Glaubens. Die Sperrmauer für das Denken wird fallen. Man wird wieder denken und endlich denken dürfen.“ Das alles wähnte man. Und der böse Feind hat die Mißstände im Raum der Seelsorge außerordentlich geschickt genutzt, um in den Gläubigen die Wahnvorstellung zu erzeugen, jetzt hören die Mißstände auf.
Das war natürlich eine Wahnvorstellung; denn statt die Mißstände zu beseitigen, brach nun im ganzen offiziellen Bild der Kirche, im ganzen Innenraum der Kirche, von oben her die Katastrophe ein: die Leugnung des Glaubens, die Verwässerung, der falsche Ökumenismus, die „Beitrags“-Ideologie, die falsche, antichristliche Ideologie vom allgemeinen, humanen Fortschritt, vom kollektiven Menschheitsfortschritt, kollektiver Menschheitsbesserung usw., usw.
Auf dem Vehikel eines falschen Wahns ritt das Verderben. Und das konnte so geschehen, weil sich viele Menschen bedrückt fühlten durch die geistige Unterernährung, durch eine verbreitete Verdummung und durch einen verbreiteten Pharisäismus. Dafür gibt es massenweise Beispiele und selbstverständlich, wenn ich das sage, weiß ich, daß es auch Ausnahmen gab.
Selbstverständlich war das nicht durchweg so, aber weithin so, und wäre das nicht so gewesen, hätten die Zerstörer, die lauernden, keine Chance gehabt. So hatten sie eine Chance. Wenn also die Wende kommt, werden wir diese falschen Bedingungen ausmerzen müssen. Ich habe begonnen, planmäßig darüber zu predigen, wie wir uns katholisch reinigen müssen, im katholischen Sinne unsere Grundeinstellung ändern, den falschen Moralismus ausschalten müssen.
Und ich habe auch schon „Über die Schönheit“ gesprochen. Moralismus ist nicht dasselbe wie Moralität. Selbstverständlich sind wir für die Moral das ist eine Binsenweisheit.
Aber am Anfang steht die Wahrheit. Und dann kommt die Wahrheit, und dann kommt drittens die Wahrheit mit ihren Inhalten, dann kommt lange nichts, und dann kommt wieder die Wahrheit, dann kommen einige Pünktchen und dann kommt erst die Moral und die Bemühung darum von selber.Denn das Gute ist das, was der Wahrheit gemäß ist. Und wenn Du die Wahrheit geschnappt hast, wirst Du automatisch nach dem Guten streben, ebenso aber auch nach dem Schönen, in Wahrheit Schönen.
Und auch da ist eine ausgesprochene Katastrophe zu verzeichnen, gerade seit dem vorigen Jahrhundert. Das hängt mit dem Einbruch der modernen Technik zusammen, die selbstverständlich ihrer ganzen Anlage und den Voraussetzungen des Menschengeistes gemäß unbewältigt bleiben mußte und immer unbewältigter bleibt.Es ist völlig falsch zu sagen, „sie hätte auch ihr Gutes gebracht“. Im Einzelfall, im Detail sicher, wenn man an medizinische Fortschritte in gewissem Rahmen und unter partiellen Aspekten denkt, gewiß, aber aufs Ganze gesehen hat die industrielle Entwicklung, die Bildung der Industriegesellschaft, die Bildung der Massenmedien und die Bildung der Masse eine fürchterliche seelische Zerrüttung, geistige Reduzierung und Einebnung und eine Verkümmerung des Denkens, eine andauernde Ausschaltung der Elite mit sich geführt.
Wir haben keine geistige Elite und keine geistige Führung mehr. Es ist ein vom Menschlichen her gesehen trostloses Bild, das sich bietet. Und ich sage, gerade mit der Industriegesellschaft, mit der Massenflucht vom Lande in die Stadt usw. hängt zusammen, daß in ganz großem Umfange der Kitsch seinen Einzug hielt. Man kann sagen, das neunzehnte Jahrhundert ist das Geburtsjahrhundert des allgemeinen Kitsches. Damals kamen Gassenhauer auf, Schlager, die Satiren. Von daher trat das Volkslied immer mehr zurück. Mit Gewalt versuchte man immer wieder, altes Brauchtum zu pflegen. Aber das hat oft etwas Krampfhaftes und Gewaltsames an sich und schlägt nicht durch.
An die Stelle von alldem ist banale Sinnlosigkeit und rührselige, falsche Sentimentalität getreten, Lebenslüge. Die Kitschromane kamen damals auf, die Küchenlieder und die falschen, bösen Darstellungen heiliger Gegenstände und Personen. Ich sage mit Absicht „falsch und böse“, nicht der ursprünglichen Absicht der Urheber nach böse, aber in ihrer Wirkung ausgesprochen böse.
Was die Darstellungen Jesu anbetrifft, so haben die einen Schaden angerichtet; man wird Jahrzehnte brauchen, um ganz langsam und planmäßig und mit intensiver Mühe diesen ungeheuren Schaden aus den Seelen auszurotten. Denn ein falsches Bild kann in seiner verheerenden Wirkung überhaupt nicht übertrieben werden. Was, meine Freunde, ist Schönheit? Zweifellos hat die Kunst mit der Schönheit zu tun. Aber was ist wahre Kunst, und wann stellt sie in gültiger Weise Schönheit dar?
Was ist überhaupt in sich Schönheit? Ich habe es schon des öfteren gesagt. Es ist der Glanz des Wesens, also das Durchleuchten dessen, was in der Tiefe des Menschen und aller Dinge, in der Tiefe der Welt und des Seienden ist. Der Gedanke Gottes, der im Urgrund leuchtet, der wird transparent, durchsichtig. Man erkennt das Wesen der Welt und das Wesen der Dinge, Also: Kunst ist die Mitteilung, Sichtbarmachung, Hörbarmachung des Urgegebenen, des unaussprechlich Tiefen, des Unsagbaren. Kunst bringt zum Vorschein wahren Wert und das, was am Anfang gedacht wurde und was im ewigen Wort enthalten ist, aus dem alles hervorgeht. Das ist wahre Kunst.
Zweifellos schildert nun Kunst auch das Gebrochensein, Vernichtung, das Zerreißen, fürchterliches Menschenschicksal. Die Kunst schildert den häßlichen Menschen und eine häßliche Landschaft wahre Kunst. Schildert sie deshalb die Häßlichkeit als solche? Sie läßt sich nicht schildern, denn die Häßlichkeit als solche, wie das Böse, das Schlechte, das Falsche in sich, ist gleich Nichts. Das Nichts haftet dem Seienden an. Häßlichkeit haftet also dem Seienden an, d.h. Häßlichkeit bricht das ursprüngliche Wesensbild, Häßlichkeit konterkariert das Aufleuchten des Wesens.
Aber wenn sie in gültiger Weise von der Kunst zum Ausdruck gebracht wird, d.h. nicht die Häßlichkeit als solche, sondern das häßliche Ding, die häßliche Sache, den häßlichen, den zerstörten, den gebrochenen Menschen, dann wird man in der Gebrochenheit: um so stärker wissend werden von dem, was da verlorengegangen ist. Im Verlust wird das Verlorene deutlicher.
Gerade im Verlust, und jeder weiß es, wird auf einmal das Wesen dessen, an das man gewohnt war, viel offenbarer. Und darum wird auch durch die Kunst, wenn sie die Fragwürdigkeit, die Bedrohtheit, die Verlorenheit, die Ausgeliefertheit des Menschenlebens, das schwere, tragische Schicksal, die tragischen, unausweichlichen Verflechtungen, in die ein Mensch geraten kann, schildert, gerade das deutlich, was da bricht und zugrunde geht. Und es leuchtet gerade durch das Gebrochene hindurch das Ursprüngliche, das Wesenhafte und Seinshafte um so deutlicher. In der Sehnsucht und in der Wehmut, die dadurch ausgelöst wird, wird das wache Wissen von dem eigentlichen Sein und Wesen um so stärker.
Denken Sie nur an die realistischen Kreuzigungsdarstellungen. „Keine Schönheit ist an Ihm, keine Gestalt“, heißt es in den Prophetien. Und gerade wenn wir Ihn so sehen, den Inhaber, den Ur-Inhaber der Schönheit, des Lebens, sterbend entstellt, dann wird beim Anblick des Entstelltseins die wehmütige Sehnsucht wach, und wir werden im Mitleiden wissend.
Das ist die Aufgabe der Kunst. Dann ist sie keine Lebenslüge. Dann kommt sie aus der Wahrheit und Wirklichkeit, aus der Tiefe und aus dem Anspruch der Tiefe. Und sie schafft Leiden und Mitleiden aus diesem geweckten Anspruch nach dem Leuchten des Ursprünglichen. Das ist Sinn der Kunst, sei es im Roman, sei es im Gedicht, sei es im Bild, sei es in der Statue.
Und sehen Sie: Schönheit Glanz des Wesens. Ein Gesicht zu sehen, das Geist, Bedeutung, Feuer, Leidenschaft, Kühnheit, Überwindung, Sieg ausstrahlt, ein solches Gesicht zu sehen ist etwas, was einem den Rücken wieder strafft, was einem wieder Lebensmut gibt. „Ich habe ein Gesicht gesehen“ ich habe einen Menschen gesehen, in dem der Genius des Ewigen, des Göttlichen durchscheint.
Die Kunst, die menschengesichtige Darstellung hat die Aufgabe, das zum Ausdruck zu bringen und sei es in seiner Gebrochenheit und Entstelltheit, um das Mitleiden zu wirken, durch Mitleid wissend zu werden. Aber wie ist so ein Gesicht? Ich habe schon gelegentlich darüber gesprochen. Sehen Sie, wenn ich mir so manche Fotografie eines großen Künstlers in seiner Jugend anschaue, dann erschrecke ich manchmal über das scheinbar flache, unbedeutende Gesicht. Man ist geradezu schockiert. Das Gesicht scheint nichts Besonderes zum Ausdruck zu bringen.
Dann sieht man das Altersbild zerfurcht und dann auf einmal entdeckt man die Bedeutung dieses Menschen. Auf einmal bricht durch, wie aus einer verblühenden Rose, der ganze große Glanz dessen, was vorher verborgen war so ist es oft im Gesicht , oder der erste geniale Glanz eines jugendlichen Antlitzes wird durch die banalisierende, einebnende, verödende Gewalt des Alltags verspießert und glatt und bedeutungslos. Wie oft erlebe ich das in meinen seelsorglichen Jahren!
Es ist mir immer ein besonderes Entsetzen, ein Schock, wenn ich ursprünglich verheißungsvolle, junge Gesichter plötzlich sehe im Zeichen von Null und Nichtig. Da ist alles dahin. Da ist alles in Gewohnheit, eingeebnet, und die Eltern kommen jubelnd zu mir und sagen: „Ach, ich habe ihnen eine freudige Mitteilung zu bringen: Endlich ist sie bzw. er anständig geworden“ usw., usw. Aber ich bin ganz und gar nicht jubelnd und froh, sondern total traurig und denke: „Damals, als noch das Chaos waltete, da war noch Chance, denn aus dem Chaos können Sterne geboren werden. Aber jetzt ist er glatt, poliert, rund, brav, alltäglich, langweilig, pflichttreu.“
Nun sagt die Frau Mama: „Nun ja, in die Kirche geht er ja nicht und religiös ist er nicht weiter engagiert, aber Hauptsache anständig.“ O weh! Das ist die Niederlage auf den Katalaunischen Feldern. Eben nicht „Hauptsache anständig“, Hauptsache Feuer und Leidenschaft. Und man erlebt es hier und da, daß im Alter der verblichene Glanz eines jungen Gesichtes wieder durchkommt durch die Kette erfochtener Siege und gewonnener Schlachten, durch die Gewalt des Leidens. Und das Leiden ist oft ein großer Künstler, welcher den Marmorstein bebaut und behaut. „Bildhauer Gott, schlag zu! Ich bin der Stein“, läßt Konrad Ferdinand Meyer in einem Gedicht den Michelangelo sagen.
Sehen Sie, das ist Kunst! Und wir werden es vertiefen, weil das in einer Predigt nicht getan ist, daß dadurch nicht ein anderes Bewußtsein erzeugt wird, aber das Bedürfnis bei Ihnen, ein anderes Bewußtsein und einen anderen Anspruch in sich hervorzubringen. Sehen Sie, gerade die Darstellungen im vorigen Jahrhundert, die sogenannten künstlerischen Darstellungen Jesu, das waren Serienherstellungen, Klischeeherstellungen, weithin in Fabriken hergestellt, die Buddhas und Herz-Jesu Bilder und Marienbilder in Serienproduktion verkauften. Die Buddhas kamen nach Indien, und europäische Reisende nahmen sie dann von Indien wieder mit nach Hause im Wahn, sie hätten indische Kunst mitgebracht, In Wirklichkeit war es Made in Germany.
Das war etwas ganz Entsetzliches: Diese Klischeebilder waren nach Art eines Anspruches gefertigt, wie er bei den sogenannten Miss-Wahlen zum Ausdruck kommt, wenn die Miss Germany oder die Miss Universum gewählt wird: nach Ebenmäßigkeit genau gemessen, glatte Haut, wohl proportionierte Züge usw. aber Nullgesichter. (Übrigens nicht alle solche Schönheitsköniginnen haben Nullgesichter. Das weiß ich auch). Aber danach wird nicht gesehen, ob der Geist sprüht oder nicht, sondern vor allem glatt müssen die Gesichter sein.
Und diese Vorstellung, so müsse man Jesus darstellen oval, glatt, mit einem Nullgesicht, mit einem wohlgeformten Bärtchen, hat in den Seelen vieler schon von Jugend an unbewußt die Vorstellung hervorgerufen, so weibisch nicht weiblich (weiblich ist etwas Herrliches), sondern weibisch , so nichtssagend, so unmännlich, so ohne Ausstrahlung muß Jesus wohl ausgesehen haben.
Und das lockt natürlich keinen gesunden Hund hinterm Ofen hervor. Und darum sind gerade gebaute Menschen, rechtwinklig gebaute junge Menschen oft, sie wissen selbst nicht warum, ohne Interesse für diese Bereiche, weil unbewußt in ihnen, wenn sie „Jesus“ hören, dieses schaurig nichtssagende, feminine Gesicht vor ihnen auftaucht. Was das für einen Schaden angerichtet hat, ist unabsehbar vom Jesusknaben ganz zu schweigen, diesem pathologischen Gebilde von einem Jungen mit dem Nachthemdchen, mit einem süßen Mädchenangesicht, eine Palme tragend.
Eltern, die so einen Jungen in die Welt setzen, werden wohl mit Schrecken alsbald dieses Gebilde zum Nervenarzt bringen und fragen, ob da noch was auszurichten wäre. Und das bietet man dann als Vorbild für Bravheit Kindern an, die von ihrem gesunden Instinkt her spielen und raufen und sportlich sein wollen usw. und denen es nicht darauf ankommt, mit wilder Gebärde Grenzen zu überschreiten, was mit Sünde rundherum nichts zu tun hat. Bravheit ist in sich kein moralischer Wert, sondern für sich gesehen ein Element des Langweiligen. Das alles muß eliminiert werden!
Und das war jahrhundertelang nicht so. Da gab es noch keine primitiven Menschen. sondern nur einfache Menschen. Der einfache Mensch ist übrigens etwas Herrliches herrlich. Aber der primitive Mensch ist etwas Schreckliches. Schauen Sie sich die Kathedralen des Mittelalters an, schauen Sie sich die Gesichter des Christus an, in Stein gehauen! Was ist das für eine Gewalt, die aus diesen Gesichtern herausstrahlt, die Ikonen, die Christusgesichter in der Apsis der Basiliken usw., usw. Durch Jahrhunderte, in der Frühzeit und im hohen Mittelalter und noch bis in die beginnende Neuzeit hinein, war die wahre Kunst selbstverständlich für jeden Menschen da. Sie sangen Volkslieder. Und die Volkslieder sind Elemente höchster Kunst, im dichterischen wie im musikalischen, bis dann auf einmal im neunzehnten Jahrhundert alles zusammenbrach und man von Seiten der Hirten und Lehrer und Priester meinte, das sei ja alles gar nicht so wichtig, Hauptsache sei das fromme Herz, das durch solchen Anblick zu Anmutungen bewegt würde.
Welch ein Irrtum, welch ein grausamer, zerstörerischer Irrtum, der den Massenabfall mitbewirkt hat! Nun werden einige kommen und sagen: „Na, das ist aber immer noch besser als diese modernen Verrücktheiten, nicht wahr, wo man z.B. einen Orang-Utan am Kreuz sieht usw. und wo man überhaupt nicht weiß, wo man dran ist.“ Ich möchte das bezweifeln. Wenn einer eine moderne Verrücktheit sieht, weiß er wenigstens gleich, es ist verrückt. Aber wenn einer Kitsch sieht, meint er, das sei doch immerhin schön. Und vor allem wenn es bunt ist und strahlt und drum herum ein Kranz von Glühbirnen ist, so wie im Jahrmarkt, dann muß es doch schön sein, nicht wahr, dann ist es doch immerhin etwas Anmutendes. Das ist falsch. Das ist kein Vorwurf. An niemanden ist das irgendein Vorwurf, sondern es ist eine Diagnose. Und wir müssen uns hier wandeln.
Vieles muß gewandelt werden, gerade in unseren Reihen, damit, wenn die Stunde X schlägt, der Heilige Geist in der zusammengeschrumpften Kirche eine Phalanx hat solcher, die bereitstehen, nun wirklich etwas Zukunftsträchtiges zu bauen vom Geiste her. Denn der Geist ist das Senfkorn, das alles durchdringen muß, der Sauerteig, der alles durchsäuern muß, der Keim, der wachstumsfähig ist nicht zu verwechseln mit dem Sauerteig des Schlechten.
Wenn ich nämlich das Gute, das Wahre, Wesenhafte mit dem Schlechten und Falschen vermische, wird immer das Falsche siegen. Ein Tröpfchen Gift vergiftet zwei Liter gute Suppe. Nicht die Mischung mit dem Schlechten, sondern die Kraft, das vorgegebene Material, das in sich gut ist, ganz zu erneuern und zu verwandeln und zu durchdringen, das ist die Aufgabe im Wahren, im Guten und ohne Dispens im Schönen. AMEN
Auszug aus einer Predigt von Pfarrer Hans Milch, 1982
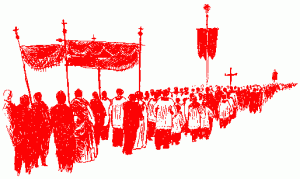
 …
…


